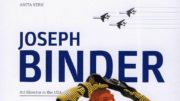Im Jahr 1981 führte Bernhard Denscher ein Gespräch mit Carla Binder über ihren Mann Joseph Binder sowie über Design im Allgemeinen und erfuhr dabei, warum Lieferautos Lichtblicke im Straßenbild von New York sein können: Carla Binder (1898-1994) war die Ehefrau, Managerin und schließlich die Nachlassverwalterin des österreichisch-amerikanischen Stargrafikers Joseph Binder (1898-1972). Dieser hat wie wenige andere Österreicher die Entwicklung des internationalen Grafikdesigns beeinflusst. Carla Binder widmete nach ihrer Heirat ihr gesamtes Leben der Arbeit ihres Mannes. Sie ging mit ihm 1936 in die USA, und lebte bis zu ihrem Tod in New York. Mit bewundernswerter Energie engagierte sie sich für die Bewahrung und Anerkennung des Werkes von Joseph Binder.
Denscher: Seit wann haben Sie Joseph Binder gekannt?
Binder: Wir haben uns ziemlich früh kennengelernt, bereits 1922 – geheiratet haben wir 1924. Auffallend an Binder war bereits damals – ich habe das in meinem Buch „Joseph Binder“ angedeutet – seine grundsätzliche künstlerische Haltung. Binder hat sich bereits als ganz junger Mensch an einem Plakatwettbewerb für die Tungsram-Lampen beteiligt, und da hat er einen Preis gewonnen und sich gegenüber den damals führenden, großen Grafikern, wie etwa Lucien Bernhard, durchgesetzt. Das war sozusagen der Beginn. Alle Leute, die ihn zu dieser Zeit gekannt haben, betonten, dass er sich ausschließlich für das Moderne interessiert hat. Besonders bei Waldheim-Eberle – damals eine der angesehensten Wiener Druckereien – haben die für Plakate und Kunstdrucke verantwortlichen Herren Binder eigentlich immer als Außenseiter empfunden, weil er so modern war, nur für das Moderne Interesse hatte. Binder war ein absolut modern denkender Großstadtmensch – man kann das gar nicht anders sagen. Er war vor allem der Ansicht: Das neue Werbeplakat muss man sofort erfassen können – die Ästhetik war selbstverständlich. Und daher hat er sich eigentlich an keine Richtung oder an keine formalen Gesichtspunkte irgendeiner Kunstrichtung angeschlossen. Er hat – beinahe möchte ich sagen – „gedacht wie ein Architekt“, der etwas bauen muss, das einen bestimmten Zweck haben soll.
Er war eine so eindringliche, starke, geradlinige Persönlichkeit, der sich kein Mensch verschließen konnte, auch nicht die Auftraggeber. Das war auch der Grund dafür, dass er relativ ohne fremden Einfluss die Sachen so machen konnte, wie er sich das vorgestellt hatte. Besonders hat ihm dabei noch geholfen, dass er sich mit großem Engagement – besonders was den Zeitaufwand betrifft – bei jedem Wettbewerb sehr bemüht hat. Und diese Arbeiten an den Wettbewerben waren nicht allein dazu da, um etwa einen Preis zu gewinnen, sondern das hat ihm in seinem eigenen Konzept immer mehr Klarheit verschafft. Das war natürlich – das sage ich immer wieder – gewissermaßen die Basis, auf der sich ein Künstler auch ein bestimmtes Prestige verschaffen konnte. Dass man also wirklich gewusst hat: dieser Mann hat ein ganz klares Konzept, der will für mich das Beste.
Denscher: Joseph Binder hat keine politischen Plakate gemacht. Hat ihn das nicht interessiert?
Binder: Doch schon, aber wahrscheinlich waren wir für die Politik nicht so interessant. Ich meine, der schönste politische Auftrag war das Plakat für das Musik- und Theaterfest der Stadt Wien 1924 – wenn man das überhaupt zur Politik rechnen will. Da war der Dr. Bach von der Arbeiterzeitung verantwortlich dafür, mit dem wir uns besonders gut verstanden haben. Dr. Bach war ein fabelhafter Mensch. Dieses Festwochenplakat hat Binder sehr viel Spaß gemacht. Damals hat sich auch der Frederick Kiesler – ein hochinteressanter Mann, wir waren mit ihm sehr befreundet in New York – an dem Plakatwettbewerb beteiligt. Binder hat sein Plakat absichtlich so vereinfacht, weil es sehr rasch hergestellt werden musste. Er hat die Lithographie selbst angefertigt, und zwar nicht auf einer Platte – dazu fehlte die Zeit –, sondern auf gummiertem Papier. Da kann man auch Abzüge machen. So wurde dieses Plakat gemacht. Und daher hat es diese große, starke, schwarze Kontur, und die farbigen Flächen sind nur hinein komponiert. Die schwarze Kontur hat er über Nacht selbst lithographiert.
Denscher: Binder hat also aus Mangel an Aufträgen keine politischen Arbeiten gemacht. Aber er war einer der wichtigsten Grafiker im Bereich der Wirtschaftswerbung.
Binder: Ja, jedenfalls von denen mit einer modernen Auffassung.
Denscher: Wie war das Verhältnis der Grafiker zueinander?
Binder: Das Verhältnis zueinander war irgendwie reserviert. Es hat jeder Grafiker seinen Kundenkreis gehabt. Victor Slama etwa hat sehr viele politische Aufträge bekommen.
Denscher: Hat es eine besondere Rivalität zwischen den Ateliers gegeben?
Binder: Man hat vielleicht insgeheim gesagt „Der ist gut“ und „Der ist nicht gut“. Aber wir haben uns jedenfalls darüber nicht geäußert. Jemand, der sich oft sehr kritisch geäußert hat, war Julius Klinger. Binder war eigentlich der einzige, den er akzeptiert hat. Wenn wir gesellschaftlich zusammengekommen sind – und Klinger nicht so aggressiv war, also sich fachlich mit dem Binder unterhalten hat –, hat Klinger betont, dass er ihn akzeptiert. Er hat aber gemeint, Binder macht zu viel, er ist noch zu üppig in seiner Gestaltung. Das hat er schon gesagt. Weil Klinger natürlich das ganz Abstrakte angestrebt hat.
Sonst war der einzige Zusammenhang zwischen den Ateliers, dass man Binders Assistenten so viel wie möglich wegengagiert hat, ohne dass es darüber zu einer persönlichen Aussprache gekommen wäre.
Denscher: Wie erfolgte damals ein Werbeauftrag? Hatte der Auftraggeber schon eine Werbeidee, mit deren optischen Umsetzung er den Grafiker betraute oder ließ er ihm völlig freie Hand und bestellte einfach „ein Plakat“?
Binder: Damals hat man als Grafiker meist die komplette Werbeidee erarbeitet. Ich glaube, für meinen Mann war immer die Farbe die entscheidende Motivation. Und wenn man dann, wie er, die Farbe in großen Flächen angewendet hat, dann hat sich alles andere sozusagen „eingereiht“. Werbeleute in den Firmen hat es damals in Österreich nicht gegeben. Einer der wenigen, der sich bemüht hat, so ein bisschen im amerikanischen Sinn zu agieren, war die Wiener Agentur „Werbemendel“. Das war – möchte ich beinahe sagen – der Beginn einer Werbetätigkeit, wie wir sie jetzt von den Agenturen kennen.
Binder hat also aus der Inspiration der Farbe und der Bemühung, der Farbe den entsprechenden Raum zu geben, die Identifikation der Werbung mit dem beworbenen Produkt geschaffen. Binder hat es stets verstanden, mit sparsamen grafischen Mitteln auszukommen. So hat er sich zum Beispiel für die Wäschefirma „Amazone“ auf Blau und Gold beschränkt und das vom Schaufensterplakat über die Schutzmarke bis zur Beschriftung für den Lieferwagen durchgehalten. Das hatte so eine optimale Kraft, die für eine andauernde Wirkung sorgte.
Denscher: Es stimmt, die meisten Plakate von Joseph Binder sind nicht von der Sprache bestimmt, sie brauchen auch keinen besonders originellen Slogan, denn sie leben von der Bildwirkung, es reicht meist nur der Produktname.
Binder: In Wien, in diesem relativ kleinen ökonomischen Raum, war das Plakat fast das ausschließliche Werbemittel und damit diese Intensität unbedingt notwendig. In Amerika, in diesem großen Raum, kommen natürlich so viele temporäre Werbemedien dazu, die dann die Sache unterstützen. Ich sehe den Werbevorgang so: Das primäre Element ist die Kommunikation in einer klaren bildhaften Form, sie ist sozusagen die Grundlage der Werbemaßnahme, alles andere ist nur eine temporäre Unterstützung.
In Amerika ist das alles gar nicht so lange her, dass man ein durchgehendes grafisches Konzept für eine Werbemaßnahme entwickelte. Besonders bemerkenswert, was eigentlich in der Fachliteratur gar nicht beachtet wird und eine ganz moderne Entwicklung hat, sind die Bemalung und der Entwurf der Lieferwagen. Die erscheinen wie ein Lichtblick (lacht herzlich) im Straßenbild New Yorks – sehr schön. Und dazu kommt, dass man sich nun auch über Industrial Design bewusst wird und diese enormen Baukräne, diese unerhörten Maschinen, von einer Größe, die man sich gar nicht vorstellen kann, dass die also jetzt auch vom Designstandpunkt behandelt werden. Man macht jetzt so eine Maschine nicht mehr in Grau, sondern das Untergestell ist zum Beispiel tiefschwarz und dann den eigentlichen Kran in einem leuchtenden Orange. Ich bin da stehen geblieben vor Bewunderung, keinem Menschen fällt das auf. Wie überhaupt in der ganzen Welt der Ästhetik dem modernen – ich will eigentlich gar nicht „modern“ sagen –, sondern dem „neuen“ Design gar keine Beachtung gegeben wird.
Denscher: Stimmt es, dass Joseph Binder über einen Artikel in der Zeitschrift „The Studio“ in Amerika so bekannt geworden ist?
Binder: Ja, damals war das so, ja. Es ist unglaublich.
Denscher: Haben Sie schon vorher internationale Kontakte aufgebaut?
Binder: Wir haben ständig englisch sprechende Schüler in unserem Studio gehabt. Und mit ihnen die lustigsten Zeiten verbracht, wir haben sie auf die Rax hinaufgeführt, Ausflüge zusammen gemacht. Wir haben über unsere Arbeit überhaupt viele interessante Leute kennengelernt, besonders die Persil-Leute waren sehr aufgeschlossen und gute Freunde.
Denscher: Die bekannten Gebrauchsgrafiker der Zwischenkriegszeit hatten damals ein sehr großes Selbstbewusstsein und stellten ihre Arbeiten oft über jene der freien Kunst. Wie war das bei Joseph Binder?
Binder: Man hat nicht den Eindruck von ihm gehabt, dass er selbstbewusst ist. Er hat ganz einfach gewusst, was er macht. Er hat immer von sich gesagt: „Ich bin ein Großstadtmensch!“ Damals haben wir die Entwicklung der Industrie sehr positiv gesehen, nicht wie heute, wo man befürchten muss, dass man zu abhängig von all dem wird. Wir haben positiv in die Zukunft geschaut. Amerika war dafür das Symbol, und Amerika war für uns auch die große Erfüllung der Karriere. Aber die Basis dafür wurde in Österreich geschaffen. Es war absolut einmalig, was da alles entstanden ist. Wenn Sie auch die Ascona-Ausstellung „Monte Verità“ besucht haben, haben Sie sehen können, dass sich in großem Ausmaß vieles davon in Österreich abgespielt hat. Als künstlerischer Mensch war man an all dem absolut beteiligt. Binder hat seine eigenen modernen Möbel entworfen und hat sie nach Amerika ausführen lassen. Unsere gesamte Wohnungseinrichtung war, soweit wir sie angeschafft haben, von Josef Frank oder der Wiener Werkstätte. Das war alles eine Frage der Überzeugung. Binder hatte ein solches ästhetisches Gefühl, dass auch das Geschirr in der Küche modern sein musste. Er war so zielstrebig und gleichzeitig ungemein liebenswürdig. Er hatte natürlich schon seine Schwierigkeiten, aber er ist damit immer selbst fertig geworden. Er hat sich nie beklagt, so wie der Klinger. Wenn ich mich ihn so beschreiben höre, so merke ich auch, dass es eigentlich ganz selbstverständlich war, dass er so gehandelt hat. Und deswegen liegt mir so viel daran, dass man diesen Geist in der Gebrauchsgrafik weiter pflegen kann, weil er es möglich macht, dass der Gebrauchsgrafiker seinen für ihn bestimmten Platz im Leben einnimmt.
DAS GESPRÄCH WURDE AM 24.6.1981 IM PALAIS AUERSPERG IN WIEN GEFÜHRT.
Herrn Dr. Gustav Belousek und dem MAK (Peter Klinger) wird herzlich für die Bereitstellung des Fotos gedankt.