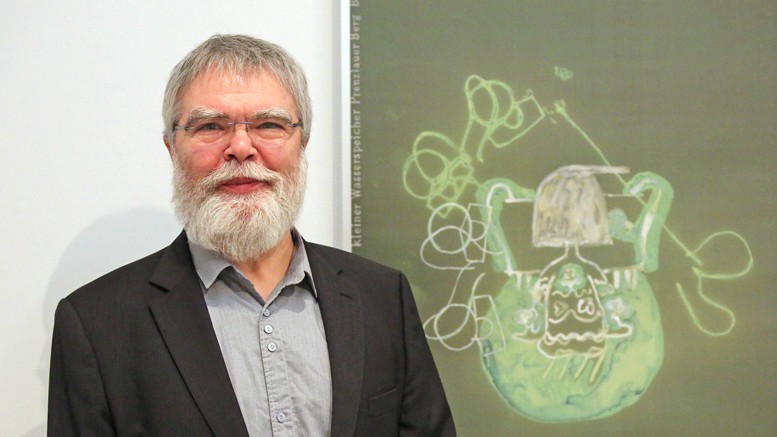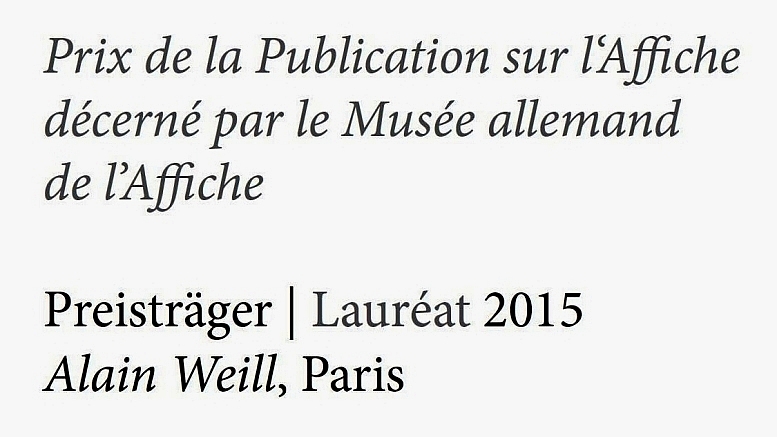Aus Anlass des 60. Geburtstages von René Grohnert am 23. Dezember 2016 führte Barbara Denscher für AUSTRIAN POSTERS ein ausführliches Interview mit dem Leiter des „Deutschen Plakat Museums“ im Museum Folkwang in Essen über dessen Werdegang und über seine Vorstellungen von einem idealen Plakat…
AP: Warum Plakate? Was ist das Interessante an Plakaten?
Grohnert: Es begann mit einem Zufall. Eine Freundin erzählte, dass sie Museologie studieren wolle. „Was ist das denn?“ – fragte ich, und sie hat das dann ein bisschen ausgeführt, und ich fand das interessant. Es ergab sich auch, dass ich einen Hilfsjob im Museum für Deutsche Geschichte in Berlin, in der damaligen DDR, bekam, und von dort aus konnte ich in der Tat 1981 dieses Museologie-Studium antreten. Und als ich nach drei Jahren zurückkam, war eine Stelle in der Plakatsammlung frei. Der Chef dieser Abteilung war Hellmut Rademacher. Da gab es dann ein schönes Ritual: jeden Freitag haben wir uns um 10 Uhr getroffen, haben Tee getrunken und über Plakate gesprochen und sind dann ins Depot. Dort hat er mir die Plakate aufgefaltet und gesagt: „So, das ist der und der, und der hat das gemacht und der kannte den, und deshalb sieht das so aus…“. Am Anfang war das alles für mich viel zu viel, ich wusste zunächst nicht recht, was ich damit anfangen sollte. Aber es kam der Zeitpunkt, wo diese Geschichten – so will ich sie mal nennen – so interessant für mich wurden, dass sie mich faszinierten. Hellmut Rademacher gab mir entsprechende Literatur, und erst da wurde mir klar, wen ich da vor mir habe. Dass ich eigentlich an der 1A-Quelle sitze. Er hat mich auch animiert, etwas über Plakate zu schreiben und zu veröffentlichen. Also: Es war alles eher ein Zufall, und glücklicherweise hat es einen Funken gegeben, der mich motiviert hat, die Sache weiterzutreiben. Ich habe dann auch auf Rademachers Rat hin ein Studium der Kunstgeschichte angeschlossen, aber immer mit dem Blick auf das Plakat. Also, um ehrlich zu sein: Ich habe mich nie intensiv um die anderen Sachen gekümmert, es ging mir eigentlich immer um Plakate.
AP: Diese erste Faszination für die Plakate – war das eher eine ästhetische Faszination, also aus der Sicht des Kunsthistorikers, oder war es eher das Interesse für das Plakat als historisches Belegstück? Und hat sich diese Faszination im Lauf der Zeit verändert?
Grohnert: Ich denke zu Anfang war es eher so die Faszination des großen, farbigen Blattes und der außergewöhnlichen Darstellungen. Denn die Leute auf den Plakaten sahen anders aus, die Autos sahen anders aus, also es war einfach eine andere Welt, die sich da auftat, und das war, so glaube ich, das erste Interessante. Der kunsthistorische Blick kam später, aber immer parallel zum dokumentarischen Blick, weil Kunstgeschichte und Plakat ja nicht unbedingt immer so eng miteinander verbunden sind, dass man sich alleine über diese Schiene mit dem Plakat beschäftigen kann. Insofern war es immer auch das Dokumentarische, das Kulturhistorische, das Alltagshistorische, wie immer man das nennen will. Immer deutlicher habe ich dann ja auch begriffen, dass das, was auf den Blättern war, nicht die Widerspiegelung der Realität war, sondern eine Mischung aus Realität und Vision. Denn mit Plakaten will man ja die Leute in eine Richtung lenken – was sie tun sollen, was sie kaufen sollen. Sie sollen sich also einerseits in der Darstellung wiederfinden, andererseits aber hängt man ihnen so die Mohrrübe vor die Nase. Und da wird es interessant zu schauen: Warum ist das so, warum sehen die so aus, was bedeutete das in ihrer Zeit? Und damit fängt es dann an, viel komplexer zu werden. Ich glaube, da habe ich eine ganze Weile gebraucht, bis mich das in seiner ganzen Breite erreicht hat. Das kam so Schritt für Schritt.

René Grohnert mit Barbara Denscher (Foto: red.)
AP: Und Schritt für Schritt ist es ja dann von Berlin auch weitergegangen. Wie verlief dann Dein weiterer „plakatistischer“ Weg?
Grohnert: Na ja, das hat so eine eigenartige Wendung genommen. Im Museum für Deutsche Geschichte war ich dann für die Plakate verantwortlich. Aber, wie das so war, nach der deutschen Wiedervereinigung gab es von vielen Institutionen – und dicht gedrängt vor allem in Berlin – immer zwei oder mehrere: unter anderem so auch zwei gleiche Museen, das Deutsche Historische Museum und das Museum für Deutsche Geschichte. Und da war nicht viel Raum, sag‘ ich mal. Da habe ich einen Zeitvertrag bekommen für eine sehr schöne Ausstellung, die hieß „Kunst! Kommerz! Visionen!“ und die konnte ich mit Hellmut Rademacher noch machen. Und wir haben dabei wirklich eine wunderbare Zeit erlebt und verlebt, weil wir all das, was wir so angestaut hatten an Wissen und Möglichkeiten, da einfach rauslassen konnten. Das war natürlich schon eine ganz tolle Sache, auch wenn sie „endlich“ war und mir auch nicht ganz klar war, wie das weitergehen solle. 1993 aber hat sich die Möglichkeit ergeben, in Hannover mit einem Auktionator, den ich über die Auktionsbesuche schon kannte, ein kleines gemeinsames Verlagsgeschäft zu eröffnen, die „PlakatKonzepte“, zu denen auch die Zeitschrift „PlakatJournal“ gehörte. Das ging dann fünf Jahre und war sehr spannend und sehr toll. Ich habe viel gelernt über An- und Verkauf, Kapitalismus, Geld, Vorsicht und Sicherheit und was man alles so an Misstrauen und Vertrauen in diesem Bereich braucht. Das war alles eine völlig neue Ebene und eine gute Schule für mich. Und Jörg Weigelt war auch ein sehr fairer Partner, es ging über die vier Jahre ganz toll – es hatte aber einen Nachteil: Es brachte nicht genug ein. Ich konnte mir den Job nur leisten, weil meine Frau Johanna damals genügend Geld verdiente, um das aufzufangen. Letztlich aber war es der Grund, warum wir in der Familie entschieden: Es ist alles recht nett, aber es ernährt den Menschen nicht wirklich. Wir haben viel zu wenig Auflage – wir wissen ja, dass das Plakatgeschäft ein sehr kleines ist im Verhältnis zu anderen. So ist das Ganze dann so ein bisschen eingeschlafen, und wir haben es dann auch beendet. Danach war ich eine Zeitlang in einem Düsseldorfer Verlag, bis sich dann die Möglichkeit ergeben hat, mit Essen in Kontakt zu kommen.
AP: Und jetzt bist Du also in Essen der Leiter des „Deutschen Plakat Museums“. Da kommen wir zu der Frage, wie Du die Positionierung dieser Sammlung siehst. Was sind die Sammlungsstrategien, was die Schwerpunkte, was ist für Dich wünschenswert für so eine Sammlung?
Grohnert: Ich habe 2005 hier angefangen und bin damals mitten hinein gekommen in den Umzug der Sammlung. Sie war über viele Jahre in einem sehr schlechten Zustand gewesen, die früheren Räumlichkeiten waren viel zu klein. Aber es gab den Restaurator Lars Herzog-Wodtke, der alles sehr stringent betrachtet hat und ein wunderbares System erarbeitete, wie man diese Dinge besser machen könnte. In diesen Prozess bin ich reingekommen und konnte den auch ein bisschen begleiten. Ab 2006/2007 hatten wir dann eine Sammlung, die zumindest durchforstbar war. Also: Wir konnten jetzt durchschauen, was wir überhaupt haben, was in einer der größten Sammlungen in Europa zu finden war. Die erste Zeit ist damit vergangen, sich zu orientieren: Was ist das überhaupt für eine Sammlung, wo kommen die Sachen her und so weiter. Es war eine Art Schatzsucherzeit. Es war auch sehr gut, dass wir eine Zeitlang keine Ausstellungen hatten und uns wirklich dieser Neustrukturierung, dieser Neulagerung widmen konnten. Dadurch wurde klar, was die Sammlung kann, aber auch, was sie nicht kann.
Wenn man jetzt also die Strategien anspricht, so gibt es mehrere Dinge. Auf der einen Seite gilt es immer noch, diese Altbestände zu erschließen und aufzunehmen. Außerdem ist natürlich eine vernünftige Sammlungspolitik zu machen, das heißt, sich zu fragen: Was ist aktuell zu erwerben? Da kommen natürlich auch von außen Ideen. Und letztlich gilt es, die entsprechende Art der Präsentation zu wählen, um das Spektrum dessen, was das Plakat zu bieten hat auch darzustellen. Also von den reinen Werbeflächen, wie wir sie 2014 in der Ausstellung „Think Big. Plakatideen für große Flächen“ zeigten, bis zum anderen Extrem, zur Frage, wann das Plakat zur Kunst wird oder wann Kunst zum Plakat werden kann. Darum geht es zum Beispiel in der Ausstellung „Emil Siemeister – Vom Rufen zum semiotischen Fallenstellen“. Das ist eine sehr spannende Sache, um einfach die gesamte Bandbreite auszuloten. Es gab natürlich auch zwischendurch Ausstellungen, die sehr populär waren, wie etwa „50 Jahre James Bond-Plakate“ und andere Dinge. Also es ist immer eine Mischung zwischen dem gewollten Publikumserfolg und der Umsetzung von wirklich fachlichen Intentionen, der eigenen und auch der von Kollegen, um so in eine Diskussion über ein Thema auszulösen zum Beispiel.

(Foto: Barbara Denscher)
AP: In den 1970er und in den 1980er Jahren waren Plakate sehr beliebt, man hat sie auch zu Hause aufgehängt. Damals hatten sie eine über die reine Werbung für Produkte hinausgehende Popularität. Mittlerweile gibt es diese Beliebtheit, meiner Meinung nach, nicht mehr. Wie würdest Du heutzutage als Leiter des „Deutschen Plakat Museums“ Leuten erklären, worin der Wert von Plakaten besteht?
Grohnert: Das Plakat war, seit es das Plakat gibt und bis in die 1940er Jahre hinein, sozusagen die mediale Leitkultur. Also: alles an Werbung richtete sich nach dem Plakat, die Plakatgestalter waren Stars, die Medienentwicklung ging sehr stark über das Plakat. Das änderte sich schlagartig, als das Fernsehen aufkam, das sozusagen zum neuen Leitmedium wurde. Das Plakat wurde natürlich totgesagt, man meinte: „Jetzt haben wir das Fernsehen, jetzt brauchen wir das Plakat nicht mehr“. Es war wie einst mit der Fotografie: „Jetzt haben wir die Fotografie, jetzt brauchen wir die Malerei nicht mehr“. Wir wissen natürlich, dass es so einfach nicht ist, mittlerweile ist auch mit dem Internet ein weiteres neues Medium aufgetaucht, aber das Plakat ist immer noch da, es hat sich aber natürlich stark verändert.
Wenn man das Plakat als historische Quelle betrachtet, dann kann man sehr schön sehen, wie die Dinge sich veränderten, die Ideale, die Umstände, die politischen Ziele, die gesellschaftlichen Ziele – all das ist natürlich sehr unverblümt auf den Plakaten abzulesen, weil sie in ihrer Zeit ja funktionieren mussten. Sie mussten den Nerv der Leute treffen, das heißt, sie mussten relativ ehrlich mit dem umgehen, was zu dieser Zeit los war, sonst hätte man den Plakaten die Botschaft nicht abgenommen. Also insofern sind sie immer ein Gradmesser dessen, was in der Gesellschaft passiert. Sie sind eben ein hervorragendes Quellenmaterial über historische und kulturelle Entwicklungen oder wie ich es gerne auf den Punkt bringe und sage: „Plakate bilden“.
Natürlich spielt das Plakat heute nicht mehr die Rolle, wie vor zwanzig oder dreißig Jahren. Vielleicht gab es diesbezüglich in den 1970er Jahren so den letzten großen Höhepunkt, wo die Dinge ins Private hineinwuchsen und man seine Gesinnungsplakate zu Hause aufhängte, auch um vielleicht die Eltern zu ärgern oder zumindest den Freunden zu zeigen, an welcher Stelle man steht. Das ging einher mit dem Dresscode, den man dann übernahm, und so weiter. Aber auch als rein dekoratives Poster gelangte es an die privaten Wände. Ich denke, man muss mittlerweile leider eingestehen, dass die anderen Kanäle wirklich wichtiger sind und das Plakat nicht mehr in Konkurrenz steht zu den anderen Medien, sondern einfach nur ein Teil von Kampagnen ist. Heute ist das Plakat in aller Regel sozusagen der Wiederholer zwischen Fernsehen, Anzeigen und Internet, weil im öffentlichen Raum natürlich das Plakat zur Verfügung steht.
Wir werden uns hier, im „Deutschen Plakat Museum“, in den nächsten Jahren natürlich auch mit der Zukunft des Plakats beschäftigen. Was bedeutet die Digitalisierung für das Plakat, inwieweit ist das Plakat überhaupt noch interessant – oder hat es bestimmte Vorzüge, mit denen andere Medien nicht konkurrieren können?

(Foto: Barbara Denscher)
AP: Kommen wir zur abschließenden Frage: Hast Du ein Lieblingsplakat und wenn ja, warum gerade dieses?
Grohnert: (Lacht) Es gibt tatsächlich eins, ja vielleicht zwei. Wenn man sich so lange mit den Dingen beschäftigt, kann man sich nicht so vorbehaltlos über etwas freuen, sondern man analysiert sofort: Von wann, von wem, in welchem Zusammenhang und so weiter. Das lässt sich gar nicht vermeiden, das ist wie ein Buchgestalter, der als erstes auf die Typografie guckt, auf den Durchschuss, auf die Seitenränder, die Bildplatzierung und was alles noch dazu gehört, und der zunächst gar nicht auf den Inhalt achtet. Diese Vorbelastung führt dazu, dass für mich Lucian Bernhards Stiller-Schuh eigentlich die Inkunabel ist. Es ist deshalb sehr interessant, weil es das erste Mal ist, dass sich das Plakat und die Werbung ganz allgemein vom direkten Zusammenhang mit der Bildenden Kunst lösen. Es wird also eine völlig eigene Formensprache für die Werbung entwickelt. Die Jungs haben damals überlegt: Was brauchen wir, was brauchen wir nicht, um die Leute im großstädtischen Kontext zu erreichen. Und das war sozusagen das Ergebnis dieser Überlegung, in dieser relativ kurzen Entwicklung, und es war derart sensationell, dass wir eigentlich heute noch davon leben. Dass diese Trennung, diese Möglichkeit sich separat auszudrücken, der medialen Aufgabe, der Aufmerksamkeit in der Großstadt zu folgen, dass man dem wirklich auch nachgeben kann und dass es Möglichkeiten gibt, die immer auch überraschend sein können, die ja auch immer wieder überraschend waren im Lauf der Jahrzehnte.
Neben dem Stiller Plakat wären auch noch das Manoli-Plakat mit der Schachtel und die Priesterhölzer zu erwähnen, das wären also die drei, die letztendlich die neue Ära einläuteten. Aber auch das Plakat für den Starnberger See von Ludwig Hohlwein ist wichtig, das ist für mich auch so eine Zäsur aus einer ganz anderen Richtung, die sehr viel dekorativer, figürlicher ist, aber die in der Lage ist, Image zu transferieren.
Ansonsten sind meine Lieblinge immer die, mit denen ich mich gerade beschäftige, weil man da relativ weit eintaucht in die Geschichte der Dinge und immer wieder Sachen entdeckt, die einen faszinieren und die halten dann auch noch eine Weile vor.